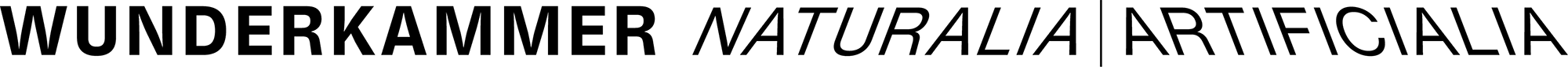Problematiken und Chancen eines Reenactements
Judith Engel, Freie Kulturjournalistin und Autorin
Die Welt zeigt sich als ein Haufen hübscher Schrott, wenn einem die Ordnungsparameter fehlen. So in etwa liest sich das Fazit des überwältigten Autors Jean de Labrune, der aus der barocken Wunderkammer des Basler Sammlers Remigius Faesch im Jahr 1686 Bericht erstattet. Kaum zu überblicken sei die eigentümliche Sammlung, in der sich neben kuriosen Dingen von solidem Wert, fragliche Objekte wie ein sehr dünnes Stück Holz und kaum besondere Steine fänden. Nach subjektiven Geschmackskriterien habe hier ein Mann mit Vermögen eine unordentliche Sammlung zusammengetragen, über die sich gerade noch „staunen“ ließe. Kuratiert hatte hier niemand.
Nun ist 2021 nicht die beste Zeit, um eine Renaissance des Staunens auszurufen. Die Welt lässt sich heute nur schwer als Ort der Wunder betrachten: die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Konsequenzen einer jahrhundertelangen westlich-kapitalistischen Verwaltungsweise der Welt treten mit aller Deutlichkeit hervor und selten schien die Welt so entzaubert zu sein wie im Moment. Nostalgie ist im Kontext dieses historischen Vergleichs unangebracht. Denn bei aller Liebe zur Rarität, bewunderte man mindestens so sehr den Status des Sammelnden wie die Sammlung selbst: im 17. Jahrhundert war nicht die Welt staunenswerter, sondern lediglich das Staunen eine angemessene Reaktion auf das Zelebrieren männlich privilegierter Machtdemonstration.
Es drängt sich der Versuch einer Rehabilitierung der Wunderkammer also nicht gerade auf. Was, das muss gefragt werden, könnte daran interessant sein, sich mit dieser Frühphase der Museumsgeschichte künstlerisch auseinanderzusetzen? Warum die Idee aufgreifen, unterschiedliche Positionen, Objekte, Kunst und Nicht-Kunst in vier Schaufenstern unkategorisiert nebeneinander zu zeigen? Lässt sich dieses Setting einer angestaubten Sammlerleidenschaft europäischer Oberschicht heute künstlerisch und kritisch produktiv machen?
Es ist vielleicht gerade die Problematik des Konzepts Wunderkammer, die sich für ein zeitgenössisches Nachdenken über Repräsentation von Welt fruchtbar machen lässt, wenn man eine Art Reenactment wagt, das gleichermaßen Begräbnis wie Versuchsanordnung ist. Begräbnis deshalb, weil sich im 17. Jahrhundert einerseits schon ein Selbstbewusstsein männlich-westlicher Überlegenheitsgewalt abzuzeichnen beginnt, auch wenn der Höhepunkt kolonialer Ausbeutung erst zweihundert Jahre später erreicht ist. Das zeigt sich schon am Selbstverständnis, dass die Welt ein Ort sei, an dessen Reichtum man sich nur bedienen müsse. Dass diese Selbstbedienung am Buffett der Wunder nur einigen wenigen vermögenden weißen Fürstensöhnen vorbehalten war, darüber dachte man wenig nach und wenn, dann ohne schlechtes Gewissen. Andererseits, und das ist ein vorsichtig formuliertes andererseits, war diese keimende Hybris westlicher Überlegenheitsphantasien in den Wunderkammern noch irgendwo zwischen Kometensplittern, mechanischen Uhren und seltenen Federn verstreut. Unter dem Vorwand des Staunenswerten fand sich hier fast unhierarchisch Wertvolles neben Wertlosem, Naturgegenstände neben Kunsthandwerk, Alltagsgegenstände neben Kuriositäten. Das Nebeneinander von Objekten, deren Eigentümlichkeit eine klare Zuordnung verunmöglichte, ist eine Art auf die Welt zu schauen, die sich mit der Moderne und dem Aufschwung der Naturwissenschaften sowie der resultierenden Trennung in Natur und Kultur radikal veränderte. War Staunen vor 300 Jahren die gesellschaftsfähige Antwort auf die kostspielige Messi-Leistung Wohlhabender und Wohlgeborener, setzt die Moderne Wissen und Erkennen an die Stelle dieser naiven, von Privilegien getragenen Faszination. Man sammelt nicht mehr wahllos, sondern sortiert die Welt mit System in Völkerkundemuseen, Naturkundemuseen, zoologischen Gärten und Weltausstellungen. Man ist nicht mehr verzaubert, sondern will den Kosmos, seine evolutionäre und ideologische Ordnung rational durchblicken und sich nebenbei selbst als Westeuropäer „wissenschaftlich fundiert“ an deren Spitze platzieren.

Dagegen mutet das ungetrennte Nebeneinander von Kunst, Nicht-Kunst, Gebrauchsgegenstand und Naturobjekt wirklich wie ein zeitgenössisches Ausstellungskonzept an, das diese Ordnungs-Strukturen hinterfragt: Ein Ort, wo zwar gesammelt wird, aber eine Topfpflanze neben einem kunsthandwerklichen Objekt mit gleicher Berechtigung steht und nicht auf Wertigkeit hin kategorisiert wird. Tatsächlich bezweckten die damaligen Sammlungen, den universalen Zusammenhang aller Dinge darzustellen, mit dem Ziel, eine Weltanschauung zu vermitteln, in der Geschichte, Kunst, Natur und Wissenschaft zu einer Einheit verschmolzen. Dass sich aber der Einheitsgedanke nie ohne die Ausgeschlossenen denken lässt, über die sich diese Einheit erst manifestiert, haben die letzten 300 Jahre wiederholt gezeigt. Die Wunderkammer, das darf trotz des demokratischen Nebeneinanders der Objekte nicht vergessen werden, suchte die Kuriosität in der Welt, so wie sie war. Es ging nicht darum, etwas zu verändern. Es ging um das Staunen über die Welt und über den Status des Sammlers, der diese Welt zusammengetragen hatte. Dieses unreflektierte Staunen und die Sammlung als Statussymbol, das muss man begraben.
Es kann sich trotzdem lohnen, zurückzugehen an diesen problematischen Ort. Ein gleichwertiges Nebeneinander von menschengemachten und naturgemachten Materialitäten erst mal zu behaupten, das kann als künstlerisch-politische Haltung und nicht als Statusdemonstration eine wagenswerte Versuchsanordnung sein.
Zu diesem Experiment gehört auch die Entscheidung des Ortes. In den Schaufenstern einer Fußgängerzone wird die Wunderkammer zum öffentlichen Ereignis und glänzt nicht länger durch Exklusivität. Hier blicken alle Vorbeigehenden beiläufig auf das Ausgebreitete, das weder als Einzelstück einer Sammlung noch als Ware erworben und besessen werden kann.
Das verändert auch die Blicksituation. Es schaut im besten Fall nicht länger ein Subjekt auf eine Sammlung von Objekten, die eine einheitliche Welt repräsentieren. Vielmehr kann es darum gehen, eine Wunderkammer zu versuchen, in der die Dinge selbst Blicke zurückwerfen: entweder die Blicke derer, die sie geschaffen haben oder des Kontextes aus dem sie stammen. Nicht, um Einheit zu schaffen, sondern, um bei aller Aufhebung von disziplinären Grenzen und Trennungen von Künstlichem und Natürlichem, darauf zu beharren, dass ein Zurückblicken und ein Blickwechsel möglich sind. Ein Zurückblicken der Dinge, die nicht bereit sind, sich der Phantasie eines Sammlers zu fügen. Ein Blickwechsel zwischen Dingen und denen, die zwischen den Dingen sind. Ein Angeschaut-Werden von Dingen, die nicht bereit sind, Einzelne zu verzaubern, sondern die einen eigenen Blick einfordern, der umgekehrt die Wunderkammer und ihre Geschichte zum Ausstellungsobjekt macht.
Judith Engel
Studierte an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart und beendet gerade ihren Masterabschluss an der Merz Akademie Stuttgart in „Forschung in Gestaltung, Kunst und Medien“. Neben der Realisation eigener künstlerischer Projekte entwickelt sie, meistens in Kooperation mit anderen KünstlerInnen und als Reaktion auf deren Arbeit, essayistische und literarische Texte. Seit 2013 schreibt sie zudem online und offline über Theater, Kunst und Performance. 2016 war sie Stipendiatin der Akademie Schloss Solitude und betreute dort bis 2019 redaktionell die Online-Plattform Schlosspost. Momentan arbeitet sie gemeinsam mit der Künstlerin und Regisseurin Sabrina Schray an dem Theaterstück „I Say I Shoot You, You Are Dead“, das von der Freischwimmen-Förderung unterstützt wird.